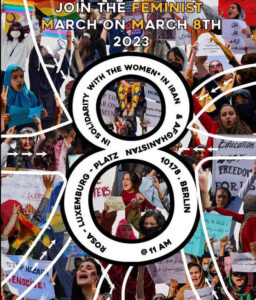Angesichts der vielen Statements und Social-Media-Diskussionen rund um die Kundgebung der „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ am Oranienplatz, wollen wir natürlich nicht zurückstehen, sondern auch noch einen etwas längeren Kommentar beitragen.

(Foto: JFDA)
Vorletzten Samstag hatte die „Jüdische Stimme“ zu einer Protestkundgebung gegen die von der Berliner Polizei ausgesprochenen Verbote der propalästinensischen Demonstrationen rund um den sogenannten Nakba-Tag aufgerufen, zu der sich ca. 300 Antizionist:innen am Oranienplatz in Kreuzberg versammelten. Gegenprotest gab es keinen, u.a. hat aber das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus die Kundgebung beobachtet und einen Bericht veröffentlicht: https://www.jfda.de/post/dritte-intifada-nakba-protest
Im Nachgang der nach bereits einer Stunde aufgelösten Kundgebung, (die Polizei hatte einen Teil der Versammlung mit dem Argument, es handele sich um eine Ersatzveranstaltung für die verbotene Demonstration der #nakba75-Kampagne am Hermannplatz aufgelöst, woraufhin die Veranstalter:innen die gesamte Kundgebung beendet haben), zirkulierten in den Sozialen Medien gleich mehrere Stellungnahmen u.a. von der “Jüdischen Stimme“, der KOP (Kampagne für Opfer rassistischer Gewalt) oder dem “Jewish Bund“. Alle beschwören darin das immer gleiche Narrativ der friedvollen und für historische Gerechtigkeit kämpfenden unterdrückten Palästinenser:innen und ihrer antizionistischen Unterstützer:innen, deren „legitimer Versuch“ der „Nakba“ zu gedenken, aus rassistischen und imperialistischen Motiven des deutschen Staates verboten werde.
Als Antifaschist:innen haben wir kein Interesse daran, staatliche Repression zu verteidigen, noch müssen wir bestreiten, dass die Demonstrationsverbote zum „Nakba“-Gedenktag und anderer propalästinensischer Veranstaltungen eine rassistische Dimension haben, die wir selbstverständlich als solche auch verurteilen. Gleichzeitig gibt es für uns keinen Grund sich mit einer vom antisemitischen Hass angetriebenen Bewegung zu solidarisieren. Vielmehr gilt ihnen als Feinden der Aufklärung und der Emanzipation – gleich wie anderen reaktionären Ideologien – unsere entschiedene Kritik.
Es handelt sich nämlich nicht, wie ihre antizionistischen Unterstützer:innen meinen und kolportieren, bloß um den „legitimen Versuch“ palästinensischen Gedenkens, der in der BRD Widerstand hervorruft, weil er eine „Bedrohung für die deutsche Erzählung vom linearen Fortschritt nach dem Holocaust“ darstelle. Das ist eine irrige Instrumentalisierung von Stichworten einer antifaschistischen Kritik an der sogenannten „Erinnerungskultur“, derer sich die pro-palästinensische Bewegung als einer Strategie – neben Kontervorwürfen (Rassismus) oder Jüdinnen/Juden, die sich vor ihren Karren spannen lassen – bedient, um vom eigenen Antisemitismus abzulenken.
Der aber, und auch der autoritäre Charakter dieser Bewegung, der rote Gruppierungen wie “Young Struggle“, “Kommunistische Organisation“ und “Revolution“ mit propalästinensischen Aktivist:innen (BDS, Samidoun, Palästina spricht) verbindet, zeigte sich auf der Kundgebung am Oranienplatz ziemlich deutlich. Während man sich einerseits von der einem wohlgesinnten Bürgi-Presse breit und lang interviewen ließ, attackierte man die, die kritisch über einen berichten (p.s. für die Freund:innen des identitären Arguments: zumeist jüdische und/oder israelsolidarische Vereine, Zeitungen, Journalist:innen) und outete sie danach im Internet, damit der Mob sich um sie kümmern möge.
Im Redebeitrag der Veranstalter:innen wurde gleich zu Anfang mit monströsen Bildern zur gemeinsamen Identifikation eines unterdrückten Kollektivs aufgewartet; das Demonstrationsverbot als nichts geringeres als „antipalästinensischer Faschismus“ ausgerufen. Um völkisch aufgeladene Identitätssuche ging es auch in der demagogischen Rede einer jungen Palästinenserin, die die Selbstdarstellung als totales Opfer mit Schuldkult-Topoi („Deutschlands historische Schuld wird mit unserem Blut reingewaschen“) und dem Aufruf an das „palästinensische Volk“ zum „Widerstand“ – means: Aufruf zu Terror und Mord an Jüdinnen und Juden („Wir sind die erste Intifada, wir sind die zweite Intifada und wir werden auch die dritte Intifada sein“) – verband. Bei dem Ausmaß an historischer Verzerrung durch Auslassung all der antisemitischen Aggression gegen Israel und der Imagination als unschuldiges Opfer fühlte man sich irgendwie ein bisschen an Jana aus Kassel erinnert. Bejubelt wurde ihre Rede mit der „From the river to the sea“-Parole, die ab da zum Dauersound der Kundgebung wurde und von der Polizei erst kurz vor der Auflösung untersagt wurde. In einer Stellungnahme des “Jewish-Bund” versuchte man dann im Nachhinein angestrengt darzulegen, warum diese Parole überhaupt nicht antisemitisch gemeint sei. Es ginge dabei um einen Aufruf zur Befreiung eines besetzten Volkes auf dem Gebiet des historischen Palästinas und für das Eintreten eines einzigen, ungeteilten Landes. Dass die Parole als (Gewalt-)Anspielung für die Vernichtung von Jüdinnen und Juden/ethnische Säuberung fungiert, wurde wenig überzeugend in eine Projektion deutscher Gewalt- und Vernichtungsphantasien auf Palästinenser:innen umgedeutet. Neben dieser inhärent völkischen Begründung (welche Linke, außer vllt. krude Antiimperialist:innen machen sich die Vereinigung eines „Volkes“ zu ihrer Aufgabe?), ist die Ignoranz gegenüber der historischen wie gegenwärtig ziemlich offen ausgesprochenen oder angedrohten Auslöschung sowie Angriffen auf den jüdischen Staat von palästinensischer/islamischer Seite, frappierend.
Auffallend, wenn auch nicht überraschend war, dass auch auf dieser Kundgebung einer vermeintlich linken Palästinasolidarität, außer ein paar verflachten Schlagworten, überhaupt keine linken, emanzipatorischen, geschweige denn kommunistischen Vorstellungen oder Inhalte zu hören waren. Stattdessen wurde bloß an eine diffuse internationale Gemeinschaft appelliert, die so scheint es, sich im Hass auf Israel vereint, das ganz nach antisemitischer Manier zum Symbol globaler Unterdrückung stilisiert wurde. Die Kundgebung war von Demagogie, Dämonisierung, Feindbildern, völkischen Ideologemen und antisemitischen Parolen beherrscht. Dabei handelt es sich mitnichten um den „legitimen Versuch“ von Palästinenser:innen, den Vertreibungen im Zuge des arabischen Angriffskriegs gegen Israel zu gedenken, sondern um einen Teil des nicht enden wollenden Israelhasses, hinter dem der Vernichtungswunsch lauert. Der wird in Parolen angespielt und von Organisationen wie Samidoun, dem Solidaritätsnetzwerk für die national bzw. islamisch motivierten palästinensischen “Märtyrer:innen“, das gerade lautstark versucht, die Palästinasolidarität anzuführen, tatkräftig bei seinem Realisierungsversuch unterstützt.
Egal ob man es als Anti-Kolonialismus oder Klassenkampf verbrämt: Sich solidarisch oder aus Betroffenheit positiv auf einen maßgeblich von islamistischen Terrorgruppen geführten Kampf zu beziehen – für ein, ja was: „freies“, d.h. vom Islamischen Dschihad oder der Hamas geführten Palästina? – ist kein linkes Projekt.
Zusammengefasst: Uns wäre auch lieber gewesen, wenn eine breite antifaschistische Organisierung diese Aufmärsche verhindert hätte – und nicht, aus meist falschen Gründen und mit staatlichem Interesse, die Polizei. Aber die Verhinderung hat wenigstens zur Folge gehabt,dass der antisemitische Mob sich nicht ungestört entfalten konnte.
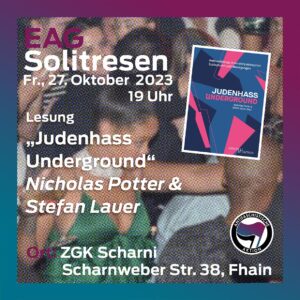

 (Foto: JFDA)
(Foto: JFDA)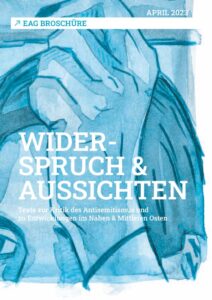 Unsere neue Broschüre “Widersprüche & Ausblicke” wurde beim Solitresen im April vorgestellt und ist jetzt gedruckt und auch online erhältlich. Sie kann hier nachgelesen werden:
Unsere neue Broschüre “Widersprüche & Ausblicke” wurde beim Solitresen im April vorgestellt und ist jetzt gedruckt und auch online erhältlich. Sie kann hier nachgelesen werden: 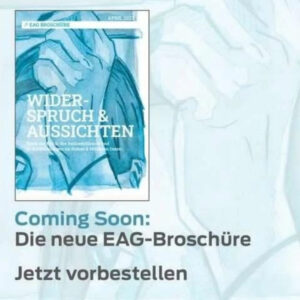

 Auch dieses Jahr haben die Apologeten des iranischen Regimes in aller Welt und auch in Berlin vor, am sogenannten Al Quds-Tag ihren Israelhass auf die Straße zu bringen. Wenn der Marsch stattfindet und nicht als „Hassdemonstration“ verboten wird, werden wir sie mit unserem antifaschistischen Protest in Empfang nehmen.
Auch dieses Jahr haben die Apologeten des iranischen Regimes in aller Welt und auch in Berlin vor, am sogenannten Al Quds-Tag ihren Israelhass auf die Straße zu bringen. Wenn der Marsch stattfindet und nicht als „Hassdemonstration“ verboten wird, werden wir sie mit unserem antifaschistischen Protest in Empfang nehmen.